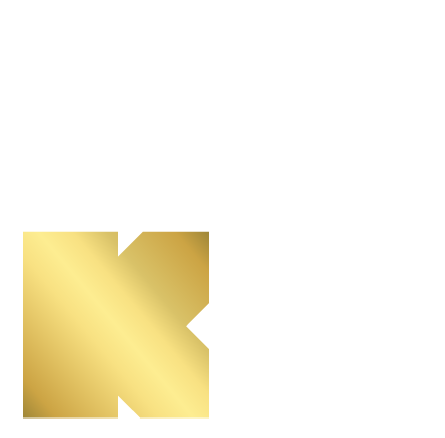»Unser Bildungssystem«
Juni 2021
Hier geht’s zur PDF und im Menü unten finden sich die Artikel, die im Heft über die QR-Codes abrufbar waren.
Wie groß ist der Anteil an Lehrkräften, die die digitalen Unterrichtsmittel befürworten und sie im Unterricht einsetzen?
Dazu gibt es unseres Wissens nach keine belastbare Erhebung.
Inwieweit reicht das Angebot an Weiterbildungen für den Einsatz digitaler Unterrichtsmittel aus, um den Bedarf zu decken?
Wir hören von Lehrkräften oft, dass sie sich mehr Weiterbildungen wünschen und bieten diese auch als GEW M-V selbst an. Meist sind diese Angebote sehr schnell ausgebucht. Allerdings sind auch dies nur Momentaufnahmen. Zu vermuten ist, dass durch den »erzwungenen« Digitalisierungsschub der Bedarf aktuell höher ist als das Angebot.
Zu welchem Anteil sind die Schulen infrastrukturell in der Lage, digitale Unterrichtsmittel flächendeckend einzusetzen?
Das berührt zwei Fragen: Es geht einerseits um die technische Ausstattung, dafür sind die jeweiligen Kommunen verantwortlich – in Rostock also Bürgermeister Madsen. Andererseits geht es um die inhaltliche Gestaltung eines digitalen Angebots. Dafür ist das Land zuständig. Bei beidem ist, das zeigen uns die Rückmeldungen aus der Umfrage des Landeselternrates und Landesschülerrates vom Januar, noch viel Luft nach oben.
Welchen Eindruck hat die GEW grundsätzlich von der neuen landesweiten Lernplattform »itslearning« insbesondere im Vergleich zu vorher eingesetzten Programmen?
Das Land hat sich für »itslearning« entschieden. Dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Dennoch ist die Nutzung dieser Plattform für die Schulen bisher freiwillig. Auch deshalb, weil notwendige Mitbestimmungsprozesse noch nicht abgeschlossen sind. Hier geht es nicht nur um die technische Seite eines Produktes. Vielmehr müssen wir auch darüber sprechen, was das für die Lehrkräfte bedeutet. Aktuell führt der digitale Unterricht zu entgrenzten Arbeitszeiten und dem Verlust von Privatsphäre. Da viele Schulen noch nicht ausreichend ausgestattet sind, müssen Lehrkräfte auf eigene Geräte und eigene Infrastruktur, wie etwa private Telefonverträge zurückgreifen und teils aus dem heimischen Wohnzimmer heraus unterrichten. Das wäre in der freien Wirtschaft undenkbar! Natürlich wissen auch die Pädagog:innen um die besondere Situation. Dennoch müssen diese Fragen thematisiert werden.
Was ist die Meinung der GEW dazu, dass immer mehr Schüler:innen zu elektronischen Geräten – insbesondere Tablets – greifen, um sich Mitschriften im Unterricht zu machen?
Wenn es eine entsprechende pädagogische Einbindung gibt – warum nicht? Wichtig wäre, dass auch dabei Pausen eingehalten werden und Mindmaps und Ähnliches zur vertieften Verarbeitung von Informationen eingesetzt werden.
Wie bewertet die GEW die Wirksamkeit der Maßnahmen, welche dem Mangel an Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern abhelfen sollen?
Bis zu welchem Grad befürwortet die GEW den Einsatz von Seiteneinsteiger:innen, um den Lehrkräftemangel abzuschwächen?
Einen Teil dieser Maßnahmen haben wir mit verhandelt und befürworten sie. Dennoch sind sie aus unserer Sicht nicht ausreichend. Wir haben ein rund 80 Punkte umfassendes Personalentwicklungskonzept entwickelt, dass vom Lehramtsstudium beginnend, über alle Berufsphasen – auch den Seiteneinstieg – hinweg, auflistet, was getan werden muss, um den Beruf attraktiv zu gestalten, Einstiege zu ermöglichen und dazu beizutragen, dass Lehrkräfte lange und gesund an den Schulen unterrichten können. Unser Ziel ist es genügend grundständige Lehrkräfte auszubilden, um den Bedarf zu decken. Wir erkennen jedoch auch an, dass zurzeit diese Zahl an Lehrkräften, aufgrund von Versäumnissen der bisherigen Bildungspolitik, nicht zur Verfügung steht. Seiteneinsteiger:innen sind unsere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen. Sie verdienen Begleitung, Unterstützung und Weiterbildung, um sich das notwendige pädagogische Rüstzeug anzueignen und Anerkennung für ihren Einsatz trotz schwieriger Arbeits- und Ausbildungsbedingungen. Klar ist aber auch, nicht alle, die Lehrer:innen im Seiteneinstieg sein wollen, dies auch können.
Wie steht die GEW zu dem Konzept, dass auch nach der Referendariatszeit noch verbindliche Hospitationen zum kollegialen Feedback durchgeführt werden, um die Unterrichtsqualität zu sichern?
Kollegiales Feedback ist in jeder beruflichen Phase wichtig und kann wichtige Hinweise für die Verbesserung von Unterricht liefern.
Welche Entwicklung beobachtet die GEW bei der Motivation neuer Lehrkräfte für den Beruf, nachdem als zusätzlicher Anreiz für das Lehramtsstudium die Verbeamtung eingeführt wurde?
Es gibt gute Untersuchungen dazu, dass nicht die Verbeamtung ausschlaggebend für die Berufswahl ist. Sie wird es erst, wenn es im Ländervergleich unterschiedliche Systeme gibt, was dann dazu führt, dass die Länder mit Verbeamtung einen Vorteil bei der Fachkräftegewinnung haben. Insofern war der Gedanke schon nachvollziehbar, auch in M-V die Verbeamtung einzuführen. Bundesweit organisiert die GEW übrigens deutlich mehr verbeamtete als angestellte Lehrkräfte. Deshalb war das für uns kein Neuland und wir können auch verbeamteten Kolleg:innen als ihre Fachgewerkschaft sehr gut zur Seite stehen. Die Verbeamtung hat viele positive Seiten für die einzelne Lehrkraft. Schwierig wird es dort, wo Beamt:innen um ihre eigenen Interessen durchzusetzen nicht streiken dürfen. Über die Besoldung entscheidet der Dienstherr ziemlich einseitig. Aber auch da sind wir als Gewerkschaft in der Interessenvertretung nicht wegzudenken.
Inwiefern sind die derzeitigen ministeriellen Maßnahmen zur Sicherung der Unterrichtsqualität aus Sicht der GEW ausreichend?
Welche sind hier gemeint? 😉 Spaß beiseite… Aus unserer Sicht haben wir einen enormen Personalmangel im Schulsystem; eine hohe Anzahl von Kolleg:innen im Seiteneinstieg, die Begleitung und Qualifizierung brauchen und zugleich viele offene Stellen. Damit ist es schwer, gut und intensiv über Qualitätsentwicklung zu reden. Feedback, Hospitationen, Schulentwicklung – all das braucht Zeit, d.h. Lehrer:innen brauchen Zeit, die sie nicht haben.
Inwieweit reichen die derzeitigen zeitlichen und personellen Ressourcen aus, um der individuellen Förderung aller Schüler:innen gerecht zu werden?
Ganz kurz: Meist gar nicht. Das muss man leider so sagen. Dem echten Anspruch einer inklusiven Schule wird M-V nach wie vor nicht gerecht.
Welche Beobachtungen macht die GEW hinsichtlich der Annahme, dass Kinder und Jugendliche von Eltern mit Hochschulabschluss eher das Abitur ablegen würden als diejenigen, deren Eltern einen solchen Abschluss nicht besitzen?
Wie bewertet die GEW dies?
Das ist nach wie vor der Fall und aus Sicht der GEW nicht hinnehmbar. An diesem Thema arbeiten wir als Gewerkschaft schon seit vielen Jahren auch auf Bundesebene.
Ist das Pensum der Rahmenpläne im Unterricht unter Berücksichtigung der Zeit für die individuelle Unterrichtsgestaltung zu schaffen? Wie häufig müssen Inhalte des Rahmenplans gestrafft werden, um seinen inhaltlichen Anforderungen gerecht zu werden?
Die GEW M-V setzt sich für einen Wandel im System ein. Circa alle vier Jahre verdoppelt sich das Weltwissen. Wir halten es nicht für zielführend, allein darauf zu setzen, bestimmte Inhalte wiedergeben zu können. Vielmehr muss es darum gehen, Kompetenzen zu entwickeln und das Lernen zu lernen. Um das zu erreichen, braucht es eine kleine Revolution. Wir arbeiten daran.
Wie bewertet die GEW die Situation hinsichtlich des Arbeitspensums der Lehrkräfte für eine Unterrichtsstunde im Vergleich von Sekundar- und Oberstufe unter Berücksichtigung, dass für beide Stunden das gleiche Zeitbudget zur Verfügung steht?
Anders als andere Interessenvertretungen ist die GEW M-V für die Lehrkräfte aller Schularten Ansprechpartnerin und Vertretung. Deshalb haben wir auch einen guten Einblick in den jeweiligen Arbeitsaufwand. Da, wo es aus Sicht der Lehrkräfte dringend notwendig ist, fordern wir deshalb regelmäßig Abminderungsstunden, etwa wenn es um Kontrolltätigkeiten oder andere Aufgaben geht. An dem Bashing zwischen Grundschule und Sek II beteiligen wir uns hingegen nicht. In allen Schulformen haben die Kolleginnen und Kollegen Aufgaben, die die jeweils anderen nicht sehen (können), die aber für alle Kolleg:innen wichtig sind, da alle mit allen Kindern mehr oder weniger arbeiten und damit Teil eines Gesamtteams sind. Gerade Kolleg:innen, die die Doppelqualifikation haben und auch in beiden Bereichen gearbeitet haben, können das bestätigen.
Wie hat sich die Leistungsbereitschaft der Schüler:innen in den letzten Jahren entwickelt?
Was meint Leistungsbereitschaft? Die Bedingungen unter denen Schüler:innen ihre Abschlüsse ablegen, haben zu allen Zeiten ihre eigenen Herausforderungen. Ein Vergleich muss deshalb immer hinken. Auch stellt sich immer die Frage, wie sehr Schulen Leistungen so herausfordern, dass Schüler:innen gerne Leistung zeigen und umgekehrt Schüler:innen sich in die Entwicklung ihrer Schule so einbringen, dass sie dort gerne leben, lernen und leisten.
Inwieweit hat sich physische und psychische Gewalt gegenüber Lehrkräften in den vergangenen Jahren verändert?
Hierzu gibt es dahingehend Zahlen, dass die Gewalt und die Gewaltbereitschaft angestiegen sind. Das entspricht auch dem Empfinden von Kolleginnen und Kollegen. Die GEW M-V hat hierzu eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Ursachen und Fakten befasst und Maßnahmen zur Abhilfe entwickeln will.
Welche Position vertritt die GEW bei der Entwicklung, dass immer mehr Schüler:innen die Gymnasien des Landes besuchen?
Die Grundsatzposition der GEW ist »eine Schule für alle«. Wir halten in unserer modernen Gesellschaft den Ansatz eines Schulsystems aus dem 19. (!) Jahrhundert in jeder Hinsicht nicht mehr für zeitgemäß. Bildung gerecht zu ermöglichen, heißt alle Schüler:innen mit ihren individuellen Voraussetzungen dort zu fordern, wo sie stark sind und dort zu fördern, wo sie Unterstützung benötigen. Junge Menschen sollen sich gemeinsam erleben können und dabei auch feststellen dürfen, dass Unterschiede bestehen und solidarische Unterstützung wichtig ist. Aber die Schulen müssen gleichzeitig in der Lage sein, alle Schüler:innen gleichermaßen beim Lernen zu unterstützen – unabhängig von ihren Lernvoraussetzungen und der Herkunft. Bildung sollte sich dabei nicht in erster Linie nach den Erfordernissen der Wirtschaft, sondern nach dem Ziel eines selbstbestimmten Lebens in der Demokratie richten.
Wir freuen uns über lernstarke Kinder und Jugendliche in allen Schulformen und wollen sie dabei unterstützen, den für sie richtigen Weg zu gehen. In unserem aktuellen Schulsystem bedeutet das, dass wir im ersten Schritt gute Schulen in allen Schularten benötigen.
Wie hat sich die Bereitschaft der Eltern, ihre Kinder und Jugendlichen gegenüber den Lehrkräften in alltäglichen Situationen zu vertreten, verschärft?
Wie bewertet die GEW diese Entwicklung und die getroffenen Gegenmaßnahmen?
Dass Eltern ihre Kinder vertreten, ist doch zunächst einmal etwas Gutes. Immerhin besser, als wären sie nicht an der Schule ihrer Kinder interessiert. Aber es hilft schon, wenn man die eigenen Kinder stärkt, den Alltag – in diesem Falle eben den Schulalltag – selbst zu bewältigen. Wenn wir von Eltern hören, die die Kinder bis in den Klassenraum hinein begleiten und dann noch die Tasche auspacken, ist das sicher das eine Extrem. Das andere sind jedoch Eltern (und auch davon gibt es viele), die sich in keiner Weise für ihre Kinder und deren Schulerfolge interessieren. In beiden Fällen ist viel Arbeit von Seiten der Pädagog:innen gefragt und eigentlich braucht es dafür und aus vielen anderen Gründen an jeder Schule mindestens eine:n Schulsozialarbeiter:in.
Welche grundlegenden Kompetenzen müssen Schulabgängerinnen und -abgänger besitzen, um ein Studium erfolgreich zu absolvieren?
Die Frage zeigt es eigentlich schon, weil Sie sie so allgemein stellen; ich möchte es aber trotzdem nochmal vorher sagen, dass wir natürlich – wie in der Literatur und der Studienfachberatungsszene üblich – zwischen zwei Arten von Kompetenzen unterscheiden. Einerseits gibt es die studiengangsbezogenen Kompetenzen. Diese sind das, was einem oft als erstes einfällt. So braucht man für bestimmte naturwissenschaftliche Studiengänge bestimmte Fähigkeiten, die in der Schule eher in den korrespondierenden Schulfächern wie Mathematik und den Naturwissenschaften vermittelt werden. Für andere Studiengänge bedarf es entsprechend anderer Fähigkeiten und damit Schulfächern. Das ist das eine und den meisten Leuten auch klar.
Ihre Frage zeigt schon, dass es da noch etwas anderes gibt, dass unabhängig vom gewählten Studienfach immer da sein muss. Diese Kompetenzen werden zunehmend wichtiger. Da ist zum einen ein hohes Maß an Selbstorganisation und an Selbstmotivation. Wir haben es an der Universität generell mit einem System zu tun, dass zum einen – mehr noch als die Schule – totale Selbstständigkeit von den Studierenden erfordert, auf der anderen Seite aber oft sehr stark reglementiert ist. Es gibt Fristen und Vorgaben wie man eine Hausarbeit zu schreiben hat. Es gibt relativ viele Spielregeln, gepaart mit einer hohen Selbstverantwortung, diese einzuhalten. Dafür muss man der Typ sein. Man muss daher darin geübt sein, sich an Spielregeln zu halten, Fristen einzuhalten, sich selbst Rituale und Prozesse zurechtzulegen, die sicherstellen, dass man diese einhält.
Dazu gehören auch Teamfähigkeit und soziale Kompetenzen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass das Zurechtfinden in einem so strikt regulierten System den Studierenden dann leichter fällt, wenn sie begriffen haben, dass sie das nicht allein machen müssen. »Nicht allein machen müssen« im Sinne von es gibt Leute, die mit einem zusammen studieren – die kann man fragen. Darum muss man sich aber selbst kümmern. Allerdings auch »nicht allein« im Sinne von, es ist ein Zeichen von Schwäche, wenn man zu seiner Universität geht und fragt. Wir erleben es auch, dass diejenigen Studierenden, die frühzeitig begriffen haben, sich zu erkundigen, was es für Hilfsangebote gibt – damit man, wenn mal etwas nicht funktioniert, weiß, an wen man sich wenden muss – dass diese erfolgreich sind.
Es gibt aber auch diejenigen, die allein kämpfen. Das sind manchmal sogar die, die gerade ein besonders gutes Abi gemacht haben, weil sie an der Schule nie Hilfe gebraucht haben. Sie mussten sich nie um Nachhilfe kümmern, sie mussten nie jemanden um Erklärung fragen. Sie sind da immer straight durchgegangen und das gelingt niemandem an der Universität – da kann man noch so gut sein.
Wenn man dann gelernt hat, dass es dazugehört, dass man sich mal eine schlechte Note einfängt oder dass man vielleicht auch mal durchfällt und dass man dann nicht gleich glaubt: Oh Gott, dann bin ich wohl falsch in dem Studium. Sondern dass man in diesem Fall merkt, da braucht man offensichtlich Hilfe und muss jetzt schauen, wo man sie herkriegt. Die Prüfung wird dann wiederholt und danach ist es auch wieder gut. Dieser Ablauf ist ein entscheidender Unterschied: wenn man in der letzten Jahrgangsstufe eine Klausur verhaut, dann schlägt die bis zur Abiturnote durch. Wenn man im Studium eine Klausur verhaut, dann schreibt man sie nochmal. Wenn diese dann mit »Sehr gut« bestanden wird, ist das erste Durchfallen völlig egal. Das ist dann gelöscht und taucht nicht wieder auf. Das einzige, was dann interessiert, ist die gute Note im Zweitversuch. Ob man die gute Note im ersten, zweiten oder dritten Versuch hatte, interessiert niemanden. Dass müssen die Leute begreifen, dass es dazugehört, mal zu scheitern und dass man dann eben einfach die Motivation haben muss, sich da irgendwie reinzuknien, was dafür zu tun und vielleicht zu merken, dass die Lernstrategie falsch war oder das falsche Thema gelernt oder nicht verstanden wurde, was der Professor eigentlich wollte. Dann macht man das beim nächsten Versuch halt besser. Wer so drauf ist, wer das gelernt hat, der hat gute Karten, dass das gelingt mit dem Studium – unabhängig vom Fach.
Wird das Erreichen der Fähigkeiten, die Sie gerade ausgeführt haben, erfahrungsgemäß durch die aktuelle Schulausbildung ausreichend gefördert?
Ich erlebe schon, so wie ich das mitbekomme, dass Schulen vermehrt versuchen, eine Selbstständigkeit und ein selbstständiges Lernen ihren Schülerinnen und Schülern auf dem Weg zum Abitur mitzugeben. Das ist sicherlich richtig. Was wir aber nicht ändern können, das ist das eben beschriebene Phänomen, dass man in der universitären Ausbildung eine schlechte Note gänzlich löschen kann. Ich glaube aber was das Wichtigste ist, ist den Schülerinnen und Schülern eine Selbstständigkeit mitzugeben. Damit sie merken, hier muss man sich jetzt auf eine Klausur vorbereiten, bei der man schon merkt, dass es eng werden kann und wo man jetzt gucken muss, ob man sich eine Lerngruppe sucht oder sich mit Leuten verabredet. Damit man diese Selbstorganisation und Selbstmotivation hinbekommt. Das ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil natürlich eine gute Lehrkraft auch eine ist, die ihre Leute motiviert und durch das geschickte Geben von Hausaufgaben zum Beispiel dazu anhält, immer am Ball zu bleiben. An der Universität muss man das ein Stück weit selbst übernehmen. Mit diesem Motivieren seitens der Lehrkräfte muss nicht schlagartig beim Wechsel von der zehnten in die elfte Jahrgangsstufe aufgehört werden, sondern das muss sich allmählich ausschleichen gelassen werden. In meiner Wahrnehmung ist das aber etwas, das in den letzten Jahren in den Schulen vermehrt geschieht. Da ist nicht jede Schule gleich, aber ich nehme das so wahr.
Das heißt, das Problembewusstsein hat sich in den letzten Jahren gesteigert, wenn es darum geht, dass das Schulsystem nicht mit dem Studiensystem korreliert?
Das haben Sie jetzt gesagt. Warum Schulen das jetzt vermehrt machen, da müssten Sie die Schulen fragen. Das kann ich nicht einschätzen. Aber dieses verstärkt die Schülerinnen und Schüler anhalten, sich selbst zu kümmern, das ist grundsätzlich etwas, das sicherlich gut ist. Und auch diese Kultur des Scheiterns mal zuzulassen. Man ist nicht gleich im falschen Studiengang, nur wenn man, nicht alles beim ersten Mal besteht. Was ich vor allem bei der Studienorientierung als eine wichtige Aufgabe von Schule ansehe ist, die Schülerinnen und Schüler in die Lage zur eigenen Selbstreflexion zu versetzen. Also sie zu befähigen, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen und einschätzen zu können. Das ist etwas, das außerordentlich wichtig ist, für die Studienorientierung. Etwas, das auch eminent wichtig ist, dann später im Studium zu wissen, wo die eigenen Lücken sind, wo man besonders viel für tun muss und wo man schon ganz gut drin ist. Dann kann man sich vielleicht eher darauf konzentrieren, die eigenen Schwächen auszugleichen. Das ist etwas, was wir in der Studienberatung beobachten, dass es Schülerinnen und Schüler oft nicht gut können. Sie können sich schlecht selbst einschätzen. Daher wünschen wir uns, dass da die Schulen vermehrt drauf eingehen. Gerade im jetzt neu konzipierten Fach »Berufliche Orientierung«.
Was empfehlen Sie denjenigen, die diese Selbstreflexion oder andere benötigte Kompetenzen auch ohne die derzeit fehlende schulische Förderung erreichen wollen?
In die Studienberatung kommen – wir machen das mit den Leuten. Die Kolleginnen und Kollegen der Arbeitsagentur in der Abi-Beratung, oder das »Team akademische Berufe«, je nach dem, wie sie heißen, machen das auch. Ein allererster kleiner Schritt wäre einen der diversen webgestützten Selbsttests oder Neigungsfindungstests, die es gibt, zu machen. Je nach dem, was man so vorhat oder wie man so drauf ist, kann man uns da auch fragen. Wenn es schon eine bestimmte Studienrichtung gibt, können wir auch Tests empfehlen. Insbesondere die Arbeitsagentur hat mit ihrem neuen Selbsterkundungstool, das sie vor ungefähr einem Jahr an den Start gebracht hat, ein sehr gutes Testtool entwickelt. Den Leuten, die sich als völlig unbeschriebenes Blatt fühlen und so gar nicht wissen, wo es hingehen soll, empfehle ich als Einstieg meistens dieses Tool. Es ist ein gutes Selbsterkundungstool – ganz bewusst kein Test im Sinne von: man kann ihn bestehen oder durchfallen. Stattdessen gibt er eine Rückmeldung, wo die eigenen Stärken liegen. Damit würde ich anfangen.
Hervorragend finde ich es natürlich, wenn die Leute dann mit sowas in die Studienberatung kommen, also so einen Test schon gemacht haben. Da kann man sich Ergebnisse ausdrucken und dann kann man schon in einem Studienberatungsgespräch auf einem viel höheren Level einsteigen und meist auch ein viel besseres Ergebnis erzielen, als wenn da jemand so gänzlich unvorbereitet vorbeikommt und dann von mir erwartet, dass ich sage, was sie oder er studieren soll. Was ich natürlich nicht tun werde.
Das wäre ein erster Einstieg, den ich den Leuten anbiete. Aber gerade in Zukunft in dem neuen Unterrichtsfach »Berufliche Orientierung« in der elften Klasse ist eine Potentialanalyse vorgesehen. Wenn man die gut macht, dann ist das ebenfalls ein sehr gutes Rüstzeug für eine Studienorientierung.
Ich habe meine Fragen soweit gestellt. Haben Sie abschließend noch eine Sache, die sie zu diesem Themenkomplex loswerden möchten?
Ja, nochmal zu der Frage, was man als Schülerin oder Schüler machen sollte, wenn man die eigene Berufsorientierung außerhalb von der Schule ein bisschen selbst in die Hand nehmen will. Es sind immer zwei Sachen, was wir eben gesagt hatten: Selbstreflexion – die eigenen Stärken und Schwächen kennen – aber ebnen natürlich auch, das fachliche Anforderungsprofil einer bestimmten Studienrichtung kennen.
Studienorientierung ist ganz oft wie ein Abgleich. Dazu muss man beide Seiten, deren Passung man herausfinden will, kennen. Man muss sich selbst kennen: was man gut kann und was man will. Das Musikgymnasium ist der Klassiker: Nur weil man musikalisch besonders begabt ist, muss man trotzdem für sich nochmal den Zwischenschritt machen und die Entscheidung treffen, ob das der eigene Beruf werden soll. Gerade aus Ihrer Schule habe ich oft Schülerinnen und Schüler, die gut in Musik sind, aber für sich die Entscheidung getroffen haben, dass sie nicht berufsmäßig Musik machen möchten und stattdessen andere Talente berücksichtigen wollen. Das ist die Option, dass man Dinge gut kann – also eine Stärke, ein Talent hat – sie aber in der eigenen Berufs- und Studienorientierung trotzdem bewusst außer Acht lässt. Das ist nicht schlimm, aber man sollte es sich bewusst machen.
Dann im zweiten Schritt kommt die Frage, was für Studiengänge man in den Blick gefasst hat. Dafür muss man auch wissen, was diese für besondere fachliche Anforderungen haben. Dieser zweite Schritt ist auch nicht ganz einfach, weil man gut recherchieren muss und sich nicht einfach nur von den Titeln irgendwelcher Studiengänge leiten lassen sollte – die klingen natürlich irgendwie immer ein bisschen cool. Es sollte einem klar werden, was für Methoden und Arbeitsweisen verlangt werden; ob es ein sehr naturwissenschaftliches Studium ist, oder ob es eher in eine andere Richtung geht. Dieser Schritt ist nicht unbedeutend, denn mit dem Titel des Studiengangs ist nicht immer sofort alles gesagt.
Es gibt zwei typische Gründe, warum Studierende insbesondere in einer frühen Phase des Studiums abbrechen: Entweder sind das Leute, die es nicht geschafft haben, mit dieser Institution Universität zu Recht zu kommen. Die haben sich keine Lernroutinen entwickelt, sind oft allein, kennen also oft auch wenig andere Studierende – sind wenig vernetzt. Sie sind es aus der Schule gewohnt, dass man ihnen sagt, was sie machen sollen und wenn ihnen keiner sagt, dass sie sich für eine Prüfung vorbereiten sollen, machen sie nichts und fallen dann durch. Sie haben also kein Lernverhalten.
Die andere Gruppe sind die, die uninformiert in einen Studiengang reingestolpert sind und nach einem oder zwei Semestern aufwachen und merken, dass es etwas ganz anderes ist als das, was sie sich vorgestellt haben. Die brechen dann auch ab.
Gerade letzteres kann man durch eine solide Vorbereitung vermeiden. Wenn man sich also ein bisschen kümmert und rauskriegt, was von einem gefordert wird und um was es da wirklich geht. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Meeresbiologie: das ist nicht Wale streicheln, sondern etwas anderes. Wenn man das rauskriegt, kann man sich die Frage beantworten, ob man da richtig ist oder nicht. Das muss man machen, da helfen wir auch bei.
Welche Fähigkeiten/Kompetenzen müssen Schulabgängerinnen und -abgänger besitzen, um ein Duales Studium oder eine Ausbildung erfolgreich zu absolvieren?
Für die Aufnahme einer Ausbildung gibt es keine per se festgeschriebenen Fähigkeiten/Kompetenzen. Der gewählte Ausbildungsberuf sollte aber schon mit den eigenen fachlichen Stärken korrespondieren. So sollte Jemand, der Bankkaufmann/frau werden möchte auch gut mit Zahlen umgehen können. Jemand, der einen technischen Beruf ergreift, sollte physikalische Zusammenhänge verstehen und jemand, der über eine Ausbildung im Büromanagement nachdenkt, sollte im sprachlichen Bereich fit sein. Insgesamt aber kommt es immer auch auf eine gute grundlegende Allgemeinbildung an.
Viele Ausbildungsbetriebe sagen immer wieder, dass es vor allem auf wichtige Softskills ankommt, um erfolgreich eine Ausbildung zu absolvieren. So gehören dazu beispielsweise Leistungs- und Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit und auch dann »dran« zu bleiben, wenn es mal schwierig wird. Über die Zugangskriterien für ein duales Studium entscheiden nicht nur die Betriebe, sondern auch die Hochschulen. Da sollte sich Interessierte vorher genau informieren.
Wird das Erreichen dieses Anforderungsprofils erfahrungsgemäß durch die aktuelle Schulausbildung der Bewerberinnen und Bewerber ausreichend gefördert?
Die Schule vermittelt wichtige Lerninhalte und bietet auch in Sachen Berufsorientierung viele verschiedene Möglichkeiten an. Den Schülerinnen und Schülern muss bewusst sein, dass sie sich schon in den Jahren vor ihrem Schulabschluss gut orientieren müssen und die angebotenen Möglichkeiten nutzen. In unserer digitalen Welt wird es den Schüler*innen leicht gemacht, sich über sämtliche Studiengänge und duale Ausbildungsangebote zu informieren. Die Schule bereitet die Jugendlichen inhaltlich auf das Leben vor, Selbstinitiative ist jedoch gefragt. Hier passt das Sprichwort »Jeder ist seines Glückes Schmied« und kann seine Zukunft selbst gestalten.
Auf welche Punkte sollte bei der schulischen Vorbereitung auf das spätere Berufsleben, insbesondere im Hinblick auf das obige Anforderungsprofil, mehr Wert gelegt werden?
Viele Jugendliche haben am Ende ihrer Schulzeit sehr unklare Vorstellungen von der Berufs- und Arbeitswelt und von ihren eigenen Berufswünschen. Hier ist deutliches Verbesserungspotenzial. So könnten die Schulen noch mehr die Berufsorientierungsangebote externer Partner, wie zum Beispiel der Industrie- und Handelskammer nutzen. Aber auch die Jugendlichen selbst sollten die verschiedenen Bildungs- und Karriereoptionen genauer unter die Lupe nehmen. Mit einer Ausbildung und beruflicher Weiterbildung, z. B. zum Meister oder Betriebswirt, hat man genauso gute Karrieremöglichkeiten wie mit einem Studium. Das ist oft gar nicht so bekannt.
Was empfehlen Sie Interessierten konkret, um das Anforderungsprofil auch ohne schulische Förderung zu erfüllen?
Wichtig ist, dass die Schüler*innen sich rechtzeitig Gedanken über ihre Zukunft machen und zum Beispiel das Schulpraktikum wirklich zur Orientierung nutzen. Dieses Praktikum ist die einzige Möglichkeit während der Schulzeit praktische Erfahrungen zu sammeln. Es kann auch durch freiwillige Praktika oder Ferienarbeit ergänzt werden, um sich noch klarer über den künftigen Berufsweg zu werden. Alle Umfragen unter jungen Berufstätigen zeigen: Frühe Einblicke in die Arbeitswelt helfen am besten bei der Entscheidung über den künftigen Beruf.
Gerade für Gymnasiasten ist es auch wichtig, die Fächer entsprechend zu wählen. Abgewählte Fächer können leicht zur Hürde für eine Studienzulassung werden. Ebenso sollten Schüler und Schülerinnen Berufsmessen und Informationstage nutzen, um sich einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen, die es in der Region gibt. Es gibt zahlreiche Studiengänge und Ausbildungsberufe mit verschiedenen Fachrichtungen und Möglichkeiten, sich durch höhere Berufsbildung weiter zu qualifizieren. Auf den großen Berufsmessen in Rostock und Stralsund ist die IHK zu Rostock regelmäßig vertreten und berät und unterstützt gerne in Sachen beruflicher Orientierung.
Guten Tag, schön, dass Sie sich die Zeit für unserer Interview genommen haben. Sie heißen Antje Siegesmund und unterrichten Biologie als auch Chemie, richtig?
Das stimmt so.
Möchten Sie uns Ihr Alter verraten oder wie lange Sie schon als Lehrerin unterrichten?
Ich bin 30 Jahre alt und unterrichte seit Februar 2020 hier am MGKK.
Waren die Fächer, die Sie heute unterrichten, auch Ihre Lieblingsfächer früher in der Schule oder wie kamen Sie auf diese Fächerkombination?
Chemie ja, Biologie nicht. Dafür habe ich eher Musik und Kunst gemocht, weil man in Biologie ganz viel auswendig lernen muss. Biologie und Chemie passen aber ganz gut zusammen und als Lehrerin muss man nichts mehr auswendig lernen – da muss man nur die Zusammenhänge verstanden haben und erklären können.
Warum sind Sie Lehrkraft geworden? Gab es ein einschneidendes Erlebnis?
Ein einschneidendes Erlebnis gab es nicht. Ich finde diesen Beruf unglaublich vielfältig, abwechslungsreich und jeder Tag ist anders – das macht es irgendwie aus. Ich gehe in die Schule und habe jeden Tag neue Herausforderungen und Situationen zu meistern. Das ist besser als ein Arbeitstag, bei dem ich jeden Tag am Schreibtisch sitze und zehn Sachen bearbeiten muss – das wäre mir zu langweilig.
Neben Ihrem Lehramtsstudium haben Sie auch noch einen Doktortitel gemacht. Wie kam es dazu?
Meine Promotion habe ich hier an der Universität Rostock gemacht. Nachdem ich Biologie und Chemie auf Lehramt fürs Gymnasium studiert hatte, bin ich erst mal nach Norwegen gegangen und habe mich als Lehrerin an der Deutschen Botschaftsschule ausprobiert. Damals war ich immer noch relativ jung und hatte eine zehnte Klasse. Auf dem Gruppenfoto war es daher schwierig herauszufinden, wer die Lehrerin war. Als ich dann zurückkam und mich sowieso schon immer für Chemieexperimente interessiert habe, bin ich darüber dann im Grunde in die Promotion gegangen. Während dieser Zeit habe ich vier Jahre täglich im Labor gestanden und geforscht. Schlussendlich kamen dann Forschungsergebnisse raus, die noch neu für die Welt waren – dafür bekommt man am Ende dann seinen Doktortitel verliehen. Daraufhin bin ich ins Referendariat nach Brandenburg gegangen und anschließend wieder hierher zurückgekommen.
Haben Sie denn vor, jetzt für immer in Rostock zu bleiben oder wollen Sie nochmal die Schule wechseln?
Grundsätzlich habe ich nicht vor, Rostock zu verlassen. Ich fühle mich hier sehr wohl.
Wie oft haben Sie früher in Ihrer Schule etwas angestellt?
Ich habe ziemlich viel Mist gebaut. Meistens allerdings hinter dem Rücken der Lehrkräfte – vor allem im Chemieunterricht. Ich habe nicht das Experiment durchgeführt, dass durchgeführt werden sollte, sondern ich habe meine eigenen Sachen gemacht. Ansonsten war ich auch viel nachmittags unterwegs, weil ich Musik mache. Dort hatten wir, wie ihr es wahrscheinlich selbst kennt, Probenlager, bei denen wir dann die Sau rausgelassen haben.
Was spielen Sie für ein Instrument?
Ich spiele Bratsche. Damals habe ich mit Geige angefangen und bin dann mit 15 oder 16 Jahren auf Bratsche umgestiegen. Seitdem spiel ich im Orchester, aber nicht professionell.
Waren Sie früher vorbildlich und haben immer Ihre Hausaufgaben gemacht oder haben Sie sie auch des Öfteren mal abgeschrieben?
Ich hatte keine Zeit, um Hausaufgaben zu machen, weil ich nachmittags viel mit Musik zu tun hatte. Daher musste ich dann meistens auf dem Weg zur Schule abschreiben. Vorbildlich nicht ganz: ich habe nichts auswendig gelernt. Gespickt habe ich gar nicht, eher habe ich, wenn es ging, abgeschrieben oder die Aufgabe einfach ausgelassen. Das Gute ist, dass man immer nur für die erste Aufgaben auswendig lernen musste. Die letzten Aufgaben sind ja immer so etwas wie: »Erläutern Sie«, »Erklären Sie« oder etwas Ähnliches, deswegen habe ich mich immer gut auf die Zwei retten können. Im Prinzip war ich eine gute, aber faule Schülerin.
Wo haben Sie Ihr Abitur abgelegt und wie gut ist es ausgefallen?
Ich habe mein Abitur in Pampow, das ist in der Nähe von Schwerin, mit der Note »gut« bestanden.
Haben Sie aus Ihrer eigenen Schulzeit einen Rat mitgenommen, den Sie jeder Schülerin und jedem Schüler geben würden?
Einige Dinge nicht so ernst zu nehmen. Einfach alles im Leben ein bisschen leichter zu nehmen und nicht so verbissen zu sehen. Weiterhin ist Zuhören im Unterricht die halbe Miete. Alles, was man in den 90 Minuten checkt, muss man sich nicht mehr alleine zu Hause aus Büchern aneignen.
Was haben Sie früher an den Lehrkräften und an Ihrer Schule gemocht?
Ich mochte sie dann sehr gerne, wenn sie offen waren und Spaß daran hatten, zu unterrichten. Das heißt zum Beispiel, dass wir Experimente gemacht haben, wenn wir mal rausgegangen sind. Also, wenn wir mal wirklich etwas unternommen haben und nicht nur stur ins Lehrbuch geguckt haben.
Haben Sie ein bestimmtes Ereignis aus ihrem Studium, das Sie bis heute noch prägt?
Ja, ein ziemlich heftiger Chemieunfall. Da ist etwas explodiert und das eine Glasstück hat die Halsschlagader getroffen. Wir waren zu dritt drum herum und haben alles beobachtet. In diesem Moment fließt natürlich viel Blut und man muss in dem Moment seine Angst zurückschrauben und absolut funktionieren. Das heißt, der eine muss den Krankenwagen rufen, der nächste hat die Wunde abgedrückt und der dritte hat dann im Prinzip versucht, die Person zu beruhigen. Wenn ich heutzutage experimentiere, habe ich diese Sache immer im Hinterkopf. Man muss damit aber respektvoll umgehen und wenn etwas passiert genau wissen, wie man darauf zu reagieren hat.
Gibt es etwas, das Ihnen an unserer Schule besonders positiv auffällt?
Der Umgang miteinander, der ist hier sehr offen und freundlich. Ich liebe es, durchs Haus zu gehen und von überall Musik zuhören – das erzeugt gleich eine viel fröhlichere Stimmung. Außerdem mag ich das Gebäude – auch die Klassenräume sind unglaublich sonnendurchflutet. Das sind einige der vielen positiven Sachen hier.
Wie steht Ihre Familie zu Ihrer Berufswahl?
Sie hinterfragen manchmal, ob mir das ausreicht, aber Sie finden das okay. Sie steht da hinter mir.
Wie viel Zeit nimmt es in Anspruch, Ihren Unterricht vorzubereiten und Leistungskontrollen zu korrigieren?
Ich setze mich mehrere Tage nacheinander hin – immer für ein, zwei Stunden, um etwas vorzubereiten. An einem Tag habe ich die Grundlagen liegen. Am nächsten gucke ich da nochmal drüber und dann am nächsten Tag nochmal. Irgendwann ist es dann soweit okay, dass es konzeptionell Sinn macht, euch das Material so zu geben und mit euch den Unterrichtsstoff so methodisch aufzuarbeiten.
Wie lange benutzen Sie die gleichen Unterrichtsmaterialien und Lernkontrollen?
Bisher habe ich noch nichts davon benutzt. Ich bin aber auch noch nicht so lange Lehrerin. Jede Klasse ist anders, daher muss ich bei jeder Klasse schauen, wie ich die Aufgabenstellung formuliere und wie viel ich in einer Stunde schaffe. Das heißt, auch die Tests werden am Ende anders, weil ich mit einer Klasse vielleicht mehr Inhalte geschafft habe und somit auch mehr abfragen kann.
Was halten Sie von dem Umgang, den manche Schülerinnen und Schüler untereinander pflegen?
An dieser Schule grundsätzlich sehr positiv. Ich komme von einer Schule, bei der es ganz anders aussah. Mir sind bisher wenig Konflikte und Streitigkeiten aufgefallen und bisher redet ihr auch sehr nett und freundlich miteinander. Es sind wenige Schimpfwörter, die ich höre. Das gefällt mir sehr gut.
Benutzen Sie häufig die Jugendsprache?
Ich bin mir da gar nicht so sicher, aber ich glaube nicht.
Möchten Sie uns abschließend noch irgendwas sagen?
Ich habe mich gewundert, warum nicht die Frage kommt, was mich ausmacht oder was ich am liebsten mag. Ich mag am liebsten Spagetti mit Tomatensoße. Wenn das nicht im Haus ist, bekomme ich schlechte Laune. Daher kann man mir, wenn man mir eine große Freude machen möchte, einfach eine große Nudelpackung schenken.
Das ist ein sehr schöner Abschluss des Interviews – danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sie heißen Hannes Tieß und unterrichten Englisch und AWT/Wirtschaft. Stimmt das so?
Das ist korrekt.
Möchten Sie uns Ihr Alter verraten oder wie lange Sie schon als Lehrkraft unterrichten?
Ich bin 37 Jahre alt und bin in Deutschland seit Oktober 2012 als Lehrkraft unterwegs.
Waren die Fächer, die Sie heute unterrichten, auch Ihre Lieblingsfächer früher in der Schule oder wie kamen Sie auf diese Fächerkombination?
Tatsächlich, Englisch – keine Frage. Das hat auch etwas mit meinen Auslandsaufenthalten zu tun. Ich habe eine Zeit lang in den USA gelebt, bin dort zur High-School gegangen, habe studiert und dort auch gearbeitet. Daher fiel mir diese Wahl verhältnismäßig leicht, auch wenn ich sie vor meinem großen Auslandsaufenthalt getroffen habe. Sprachlich war ich etwas begabter als in den typischen naturwissenschaftlichen Fächern. Wirtschaft als solches gab es so gar nicht – wir hatten zwar AWT, aber das Fach an sich wurde unterrichtet von Geschichts-, Geografie- und Sozialkundelehrkräften, die sich die Themen untereinander aufgeteilt hatten. Wirtschaftsthemen sind auch gesellschaftspolitische Themen und die hängen unmittelbar miteinander zusammen. Durch diese Vielseitigkeit kam ich tatsächlich zum AWT-Studium.
Warum sind sie Lehrkraft geworden? Gab es ein einschneidendes Erlebnis?
Also ein einschneidendes Erlebnis war, dass ich kurz nach dem Abitur angefangen habe, als Fußballtrainer zu arbeiten. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und ich habe dann natürlich auch mal für mich reflektiert, was meine Stärken und Schwächen sind. Diese typische Berufsorientierung, wie wir sie heutzutage haben, gab es damals noch nicht. Das heißt, die erstbesten Begleiter waren letztlich die Eltern und somit habe ich mich mehrfach mit meinen Eltern hingesetzt und mit ihnen über meine beruflichen Möglichkeiten gesprochen. Mein Vater war es dann tatsächlich, der mir vor 16 Jahren vorgeschlagen hat, Lehrer zu werden.
Sie waren in den USA. Wann waren Sie das erste Mal dort?
Das allererste Mal zu Besuch war 1997. Ich war da 13 Jahre alt und in der siebten Klasse – daran kann ich mich sehr genau erinnern. Damals habe ich eine ganz typische Rundfahrt in den USA gemacht. Das war wirklich nur ein Urlaub. Drei Jahre später dann habe ich ein Auslandsjahr absolviert und bin an die High-School gekommen. Daher kommt auch meine Beziehung zu den USA.
Wo waren Sie?
In Tustin, Südkalifornien. Etwa eine Autostunde südlich von Los Angeles.
Haben Sie während Ihres Auslandsjahres einen US-amerikanischen Abschluss gemacht?
Ja, ich habe dort meinen High-School-Abschluss gemacht. Das ging nur deshalb, weil ich dort ein »Senior« war. Ich bin also in die zwölfte Klasse gegangen, obwohl ich eigentlich ein Elftklässler gewesen wäre. Für den Abschluss konnte ich mir viele Leistungen aus Deutschland pragmatisch und unproblematisch anrechnen lassen, aber dennoch musste ich bestimmte Fächer belegen, um den Abschluss zu erhalten. Zusätzlich hatte ich noch Vorgaben von meiner deutschen Schule, damit ich dort dann weiter machen konnte, wo ich aufgehört habe, ohne das Jahr wiederholen zu müssen.
Nachdem Lehramtsstudium sind Sie noch einmal in die USA gegangen und haben dort dann auch schon gearbeitet?
Exakt. Tatsächlich war es eigentlich so, dass ich sehr gerne reise. Für mich ist es eine tolle Erfahrung, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und sich mit anderen Perspektiven auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass sollte man schon einmal in jungen Jahren gemerkt haben – wie das funktioniert und dass wir auf der Erde doch mit vielen Menschen Gemeinsamkeiten haben, die uns geografisch so fern sind. Vor diesem Hintergrund lag es einfach nah, noch einmal in die USA zu gehen. Es war dann tatsächlich so, dass ich während meines Studiums regelmäßig ins Ausland gegangen bin – für das »Erasmus-Semester« zum Beispiel. Als ich dann 2009 nach fünf Jahren mein Studium abgeschlossen hatte, war es eine denkbar schlechte Zeit, um als Lehrkraft mit der universitären Ausbildung fertig zu werden. Somit habe ich aus der Not eine Tugend gemacht und hatte dann glücklicherweise das Angebot für ein Stipendium bekommen, mit dem ich 2010 in den USA studieren konnte. Bevor ich damit angefangen habe, habe ich dann dort auch schon gearbeitet.
Also haben Sie dort Ihr Studium fortgesetzt und sind nicht direkt in den Schuldienst eingestiegen?
Genau, ich habe nicht direkt im Schuldienst angefangen, weil es keinen Weg dafür gab. Es war sehr schwierig, überhaupt eine Stelle in Deutschland zu bekommen. Ich hatte auch nicht so einen schlechten Abschluss: 1,6. Aber in ganz Mecklenburg-Vorpommern habe ich gar nichts bekommen, auch in elf anderen Bundesländern hatte ich mich beworben und es kam keine Referendariatsstelle dabei heraus.
In den USA sind Sie dann auch nicht direkt in den Schuldienst eingetreten?
Nein, ich habe in einem ganz anderen Bereich als Assistent für den Direktor des »Center for Global Education« – einer Koordinationsstelle für Studierende, die ins Ausland gehen wollen – gearbeitet. So habe ich ihm tagsüber geholfen und bin dann abends zur Uni gegangen.
War das auch in Kalifornien?
Ja, das war auch in Südkalifornien. Eigentlich lag das auf der Hand, aber ich hatte mich ein Jahr zuvor noch damit beschäftigt, mir andere Universitäten anzugucken. Dafür bin ich dann durch die USA gereist und habe Gespräche geführt, aber schlussendlich war das Stipendium ausschlaggebend. Meinen »Master« dort habe ich in »Internationalen Beziehungen« gemacht – es ist also ein komplett anderes Studium gewesen. Natürlich gab es auch da wieder Überlappungen und Überschneidungen mit wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Themen, aber im Kern war es doch etwas ganz anderes. Damit konnte ich mir tatsächlich einen Traum erfüllen und vieles miteinander verbinden.
Als Sie das Stipendium hatten, haben Sie den Aufenthalt in den USA dann als Überbrückung oder eher in Richtung Auswanderung geplant?
Als ich 2009/2010 rüberging, war es so, dass ich da eigentlich nur zum Studium hingegangen bin. Das war meine Grundannahme. Dann aber mit zunehmender Zeit habe ich nach zwei Jahren in einem ganz anderen Bereich als im Bildungswesen gearbeitet. Ziel der Firma in Südkalifornien, für die ich gearbeitet habe, war es, Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und mit völlig verschiedenen Interessen zusammenzubringen. Bei dieser Arbeit mit so vielen unterschiedlichen Menschen konnte ich gut netzwerken – sprich mir berufliche Kontakte aufbauen. Das hat mir neue Türen und Tore geöffnet und dann bin ich einfach erst einmal dageblieben auch, weil es sich nach dem Studium nicht mehr ergeben hatte zurückzugehen. Mit der Zeit hatte ich dann aber schon insgeheim das Bedürfnis, wieder zurückzukommen. Tatsächlich war es dann ein Anruf von der ehemaligen Chefin des Staatlichen Schulamts Rostock, Frau Kunze, die mich mitten in der Nacht kontaktiert hat, weil mein Vater ihr meine Nummer gab. Nach diesem ersten Gespräch habe ich dann auch eine Mail von ihr bekommen und so kam das eine zum anderen. Es war also wirklich Zufall, auch, wenn ich mich nach diesem Anstoß aktiv darum gekümmert habe, dass ich nach Deutschland ins Bildungswesen zurückkehre.
Die Schulamtsleiterin hat Sie also gesucht, weil Lehrkräfte gefehlt haben?
Zu diesem Zeitpunkt war es dann so. In kürzester Zeit drehte sich das Blatt auf einmal und es wurde gerade für den Bereich Werken und Technikunterricht, was ja zu Wirtschaft zählt, händeringend nach Lehrpersonal gesucht. So kam dann das eine zum anderen: Mein Studium in den USA war beendet, ich wollte zurück zu meiner Familie und hatte auch einen Anlass dafür. In den Vereinigten Staaten habe ich nämlich gemerkt, dass ich wieder unterrichten möchte. So gerne ich die Erfahrungen drüben gemacht habe – sie sind es wert; und so dankbar ich dafür bin, dass ich das machen und erleben konnte, bin ich jetzt sehr froh, dass ich wieder hier bin und das mache, was ich machen kann und darf.
Nutzen Sie Ihren Master in »Internationalen Beziehungen« aus den USA heutzutage beruflich oder haben Sie hier eine Vollzeitstelle als Lehrer?
Momentan bin ich nur zu 25% an der Schule, dementsprechend ist auch mein Stundenkontingent verhältnismäßig gering. Die nächsten zwei Jahre bin ich auf jeden Fall noch bei der Universität Rostock, dort bin ich im Bereich der Fachdidaktik zuständig für die Ausbildung neuer Lehrkräfte. Daher habe ich momentan fast gar nichts mit meinem früheren Arbeitsfeld zu tun.
Planen Sie, diesen Abschluss später einmal zu nutzen?
Ein Abschluss in diesem Bereich öffnet einem viele Türen und Tore – so war es auch in den USA der Fall. Doch momentan sehe ich gar nicht die Notwendigkeit, etwas zu ändern, weil es mir so gut geht und ich gerne das mache, was ich gerade mache. Wenn man etwas herumspinnt, klar könnte man das noch machen. Ich bin der Meinung, noch jung genug zu sein, um später noch etwas anderes machen zu können. Allerdings bin ich wirklich glücklich als Lehrer und ich hoffe, man merkt auch, dass ich gerne zur Schule gehe und dass ich gerne junge Menschen unterrichte. Insofern sehe ich da momentan keinen Bedarf dran, etwas zu ändern.
Dann bleiben wir bei Ihrer Tätigkeit hier an der Schule. Sie haben sicher früher an Ihren Lehrkräften bestimmte Eigenschaften, bestimmte Methoden gemocht. Setzen Sie diese heute selbst um?
Mir geht es darum, dass ich den Schülerinnen und Schülern für ihre schulische und dann später auch berufliche Entwicklung etwas mitgebe. Daher denke ich, dass man über den reinen Fachunterricht hinausgehen sollte – wir arbeiten ja beispielsweise jetzt schon themen- und fächerübergreifend.
Was ich darüber hinaus als eine grundlegende Methodik für meinen Unterricht festgelegt habe ist der Umgang miteinander. Für mich kommt Respekt anderen gegenüber nicht durch das Alter oder den Studienabschluss, sondern durch das, was ich mache und wie ich es umsetze. Da geht es mir tatsächlich um ganz normale Fähigkeiten und wie man miteinander umgeht. Beispielsweise gegenseitiger Respekt, den man hat und haben sollte. Ich denke, das ist eigentlich die Basis des Zusammenarbeitens.
Wenn die Basis das gemeinsame Miteinander ist, beziehen Sie dann ihre Schülerinnen und Schüler in die Auswertung Ihres Unterrichts mit ein?
Also ich versuche es so gut wie möglich zu machen. Das Ganze fällt mir leichter, umso älter die Schülerinnen und Schüler sind. Das mache ich, weil ich möchte, dass die Schülerinnen und Schüler Wünsche äußern und so mitwirken können. Wir haben Räume zur freien Gestaltung in den Rahmenplänen, die uns zur fachlichen und pädagogischen Umsetzung zur Verfügung stehen und gemeinsam gestaltet werden können. Ich finde es wichtig, dass man die Schülerinnen und Schüler aktiviert, damit sie wissen, dass sie in bestimmten Themenbereichen mitmachen und mitgestalten können. Zudem frage ich mich auch, welche Themen euch im Moment interessieren – gerade im Bereich Englisch kann man da vieles integrieren. Das merke ich auch an der Universität: es gibt hervorragende methodische und wissenschaftliche Möglichkeiten, die aber nicht eingesetzt werden. Das hat unterschiedliche Gründe: einerseits kann es mit der Lehrkraft zu tun haben, andererseits kann man auch immer nur das umsetzen, wofür man die nötige Infrastruktur zur Verfügung hat.
Das heißt, Sie bräuchten für die Umsetzung der neuen oder besseren Methodik mehr Infrastruktur?
Es würde auf jeden Fall helfen. Technische Infrastruktur würde auch insofern helfen, als dass man den Lehrkräften unter die Arme greift und ihnen sagt, womit konkret Unterricht gestaltet werden kann. Den Schülerinnen und Schülern hilft man so ja letztendlich auch. Ich bin für mich aber trotzdem immer noch der Meinung, dass lernen ein sozialer Prozess ist. Er sollte im Rahmen der Schule stattfinden, wo genau – ob drinnen oder draußen – ist grundsätzlich nicht das Thema, denn es gibt unterschiedliche Lernorte. Genau dieser Prozess, den man zusammen bestreitet, kommt momentan in der digitalen Form zu kurz. Um das auszumerzen gibt es Formen des digitalen Unterrichts, für den uns aber derzeit die Infrastruktur fehlt. Aber selbst mit derartigen Verbesserungen würde der digitale Unterricht für mich eine Ergänzung bleiben, damit die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern nicht zu kurz kommt. Wie dringend die Interaktion ist, hat man gemerkt, als man sie mehrere Wochen und Monate nicht hatte – da hat sie uns allen gefehlt.
Was würden Sie sich als Infrastruktur konkret wünschen?
Ich würde mir zunächst tatsächlich ein ganz anderes Narrativ wünschen – es sollte daher nicht als Last empfunden werden, den Unterricht digital zu gestalten. Laptops und Internetanschlüsse können natürlich helfen, aber das alles bringt nichts, wenn jeder sein eigenes Ding macht. Man sollte daher bestmöglich transparent vorgehen und ich denke, was das angeht, stecken wir momentan noch in den Kinderschuhen – auf unterschiedlichen Ebenen: schulisch genauso wie im Großen und Ganzen auf Landesebene. Gerade da hat uns die Corona-Krise gezeigt, wo wir Defizite haben. Man kann jetzt nicht erwarten, dass sich das sofort bessert, aber man kann erwarten, dass daran gearbeitet wird. Ich denke, das passiert auch nach und nach. Aber da dieser Prozess Zeit in Anspruch nimmt, kann es manchmal etwas frustrierend sein.
Welches Ihrer Hobbys lässt Sie sich vom Schulalltag erholen?
Tatsächlich muss ich zunächst einmal sagen, dass ich in der Schule zwar arbeite, es aber trotzdem angenehm für mich ist. Dennoch habe ich Hobbys und Freizeitinteressen. Ich gehe sehr gerne Kitesurfen oder Segeln, bin daher Wassersportler durch und durch. Außerdem bin ich ein leidenschaftlicher Gärtner – was ich nie gedacht hätte. Mittlerweile verbringe ich sehr viel Zeit im Garten, auch weil man das Resultat seiner Arbeit unmittelbar sieht – gewissermaßen ein Ausgleich zu meinem Beruf. Als Lehrkraft nimmt es Jahre in Anspruch, eine Klasse bei ihrer Entwicklung von der fünften bis zur zwölften Jahrgangsstufe zu begleiten. Was die eigene Arbeit gebracht hat, sieht man dann meistens erst nach Jahren – oder beim Klassentreffen.
Üben Sie Ihre Hobbys Kitesurfen und Segeln im Verein aus?
Ich habe es tatsächlich eine Zeit lang im Verein gemacht, im Rostocker Yachtclub. Das hat mir auch unnormal viel Spaß gemacht, aber es ist sehr zeitintensiv und sehr bindend – vielleicht bin ich dafür etwas zu individuell. Ich bin aber trotzdem nie allein auf dem Wasser, gestalte mir diese Zeit aber lieber selbst als im typischen Verein mit all seinen Verpflichtungen. Solche Verbindlichkeiten hatte ich ja bis zum Ende meiner Schulzeit und danach auch noch als Fußballtrainer – von daher bin ich momentan nicht ganz undankbar, wenn ich da etwas freier bin.
An dieser Stelle bedanke ich mich für das Interview.
Frau S. Joost (Sozialkunde und Sport)
Wie empfanden Sie das Homeschooling?
Die Coronazeit war und ist eine völlig neue Situation. Positiv war die Erkenntnis, dass Leistung nicht alles ist und durch so »kleine Viecher« schnell unsere ganze Vorstellung vom Leben durcheinandergeraten kann. Man konnte sich darauf besinnen, was wirklich wichtig ist! Allerdings fehlte mir meine Aufgabe, die persönlichen Kontakte mit Freunden und mit Schülerinnen und Schülern. Besser wurde es erst, als ich mit den Videokonferenzen begonnen habe, da konnte ich wenigstens via Bildschirm mit den Schülerinnen und Schülern zum Lernstoff und zu persönlichen Dingen kommunizieren.
War die Aufgabenfülle, die Sie aufgegeben haben, groß?
Ich würde sagen, sie war angemessen. Allerdings habe ich auf Druck verzichtet, weil meine persönliche Erkenntnis war, dass Lernstoff nicht »alles« ist. Auch war mir klar, dass man von Kindern nicht erwarten kann, 90 min pro Fach intensiv an Arbeitsblättern und Texten zu arbeiten, das kann keiner leisten. Schon gar nicht für die regulär vorgesehenen vier Blöcke am Tag.
Woran haben Sie bemessen, wie viele Aufgaben die Schülerinnen und Schüler von Ihnen bekommen?
An meiner Erfahrung und den bereits geschilderten Erwägungen.
War es für Sie anstrengender, am Computer zu arbeiten, anstatt in der Schule?
Es war eine Umstellung und insofern aufwendiger, da man nicht die Möglichkeit hatte, den Schülerinnen und Schülern verbale Erklärungen mitzugeben, daher musste alles so formuliert werden, dass es selbsterklärend war. Manchmal rauchte mir wirklich der Kopf: In Videokonferenzen muss man als Moderator extrem konzentriert sein, um alle Beiträge aufzunehmen und das Gespräch zu leiten. Daher ist es verständlich, dass mehr als 45 min Videokonferenz kaum Sinn machen. Und dann hatte ich ja selbst auch noch meine Kinder zu Hause.
Hatten Sie feste Abgabetermine, die die Schülerinnen und Schüler einhalten mussten?
Ich habe frühzeitig angefangen, mich mit Videokonferenzsystemen zu beschäftigen und habe dies dann mit Schülerinnen und Schülern getestet. Wir haben es dann so gemacht, dass 45 min Vorbereitungszeit einzuplanen waren, um eine Wissensbasis zu schaffen und wir dann 45 min Auswertung und Diskussion in der Videokonferenz abgehalten haben. So mussten die Schülerinnen und Schülernatürlich entsprechend regelmäßig vorbereitet sein.
Haben Sie aufgegebene Aufgaben benotet?
Ich habe nur bei einer Klasse einigen Schülerinnen und Schülern die dringende Empfehlung gegeben, ihre Ergebnisse einer komplexen Aufgabe zur Bewertung abzugeben. Das geschah auf Grundlage der bisherigen Noten und es lag in ihrem Ermessen, ob sie das Angebot annehmen wollten. Das erschien mir fair in Anbetracht der Lage.
War es Ihnen möglich, Onlineseiten zu nutzen?
Ich habe anfangs das Fuxnoten-Modul genutzt, um Arbeitsblätter und Links zur Verfügung zu stellen, allerdings war die Kapazität dort sehr begrenzt. Vom Ministerium wurde uns eine Liste mit Websites zur Verfügung gestellt, leider sind diese durch die Masse der Zugriffe regelmäßig wegen Überlastung zusammengebrochen. Also war das auch keine Alternative.
Fanden in Ihrem Unterricht Online-Konferenzen statt?
Wie schon erwähnt – ja! In allen Sozialkundekursen habe ich es nach den Osterferien etabliert und Erfahrungen dazu gesammelt. Nur meine Sportklasse musste sich eigenständig betätigen, aber sie haben auch eine »Outdoor-Challenge« von mir bekommen, wo sie sich auspowern konnten.
Videokonferenzen waren meiner Meinung nach ein gutes Mittel, um Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu halten und immer wieder auch Unterrichtsinhalte zu besprechen und Fragen zu beantworten. Mittlerweile habe ich auch ein Tool, welches das parallele Abspielen einer Powerpoint-Präsentation im Hintergrund ermöglicht beziehungsweise eine Tafel einblenden kann. Die Schülerinnen und Schüler waren mir natürlich technisch voraus, aber ich denke, sie fanden es im Allgemeinen gut, dass man sich mit digitalen Möglichkeiten auseinandersetzt. Da müssen wir dringend besser werden! Allerdings waren die Erfahrungen nicht durchgehend positiv, es gibt Grenzen des Digitalen. Mich hat zum Beispiel die mangelnde Kontrolle gestört. Ich habe immer mit Kamera übertragen, da es zumindest das Gefühl einer guten Kommunikation vermittelte. Einige Schülerinnen und Schüler haben ihre Kamera ausgestellt, wodurch ich mich ständig wiederholen musste (sehr anstrengend) oder sie behaupteten, dass diese defekt wäre. Kann ich ihnen da vertrauen? Entscheidet selbst.
Herr J. Pestlin (Physik und Philosophie)
Wie empfanden Sie das Homeschooling?
Anstrengend. Das war eine Situation, auf die man als Lehrkraft nicht vorbereitet ist. Unterrichten macht nur in der Schule wirklich Freude.
War die Aufgabenfülle, die Sie aufgegeben haben, groß?
Ich denke, dass die Aufgabenmenge manchmal zu groß und manchmal zu gering war. Hier das genaue Maß zu treffen über Wochen ist sehr schwer, da einem der unmittelbare Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern fehlt.
Woran haben Sie bemessen, wie viele Aufgaben die Schülerinnen und Schüler von Ihnen bekommen?
Ich habe gesagt, dass meine Klassen 90 Minuten für einen Block regulär Zeit haben. In der Zeit muss die Aufgabe gelesen, verstanden, vorbereitet und dann bearbeitet, verschriftlich sowie eventuell abgegeben werden. Da bleiben letztlich circa 60 Minuten reine Arbeitszeit übrig. An diesem Zeitfenster haben sich dann die Aufgaben orientiert.
War es für Sie anstrengender, am Computer zu arbeiten, anstatt in der Schule?
Auf jeden Fall. In der Schule bekomme ich unmittelbar eine Rückmeldung, falls etwas unklar ist. Bei den Online-Aufgabenstellungen musste ich so kleinschrittig vorgehen, dass die Schülerinnen und Schüler es letztlich komplett allein verstehen sollen, ohne mich direkt fragen zu können. Und nein, E-Mail-Kontakt bringt hier nichts. Versteht ein Schüler oder eine Schülerin eine Aufgabe nicht, dann bräuchte man direkte Möglichkeiten zum Antworten.
Hatten Sie feste Abgabetermine, die die Schülerinnen und Schüler einhalten mussten?
Ja, feste Termine hatte ich. Ich habe aber letztlich alles akzeptiert, was auch verspätet eingereicht wurde.
Haben Sie aufgegebene Aufgaben benotet?
In der Sekundarstufe habe ich abgegebene Aufgaben positiv in die Endjahresnote einfließen lassen. In der Oberstufe habe ich ganz normal weiter bewertet.
War es Ihnen möglich, Onlineseiten zu nutzen?
Ja, für Physik und Philosophie gibt es glücklicherweise viele Angebote, aber ich habe auch angefangen, eigene Videos von Versuchen zu machen, damit die Schülerinnen und Schüler darauf zugreifen konnten.
Fanden in Ihrem Unterricht Online-Konferenzen statt?
Ja, aber letztlich leider zu wenig. Dies hängt auch damit zusammen, dass eine Online-Stunde leider sehr umfassend vorzubereiten ist, vor allem in Physik. Ich denke, dass ich hier viel hätte anders machen müssen.
Herr S. Reblin (Geschichte und Geografie)
Wie empfanden Sie das Homeschooling?
Es war eine sehr eigenartige Gefühls- wie Arbeitslage. Zu Beginn hatte ich durch die an sich anstehende Englandfahrt für Klasse 10 bereits alle Aufgaben erarbeitet, sodass die ersten beiden Wochen relativ »entspannt« waren. Als ich jedoch versucht hatte, mir in bestimmten zeitlichen Abständen aus allen Klassen – mit Ausnahme von Klasse fünf – Aufgaben zusenden zu lassen, war der Zeitaufwand deutlich höher als gewohnt. Zum einen entstand ein großer Verwaltungsaufwand durch den stetigen E-Mail-Verkehr auf verschiedenen Plattformen. Zum anderen dauert eine Korrektur für mich am PC länger als per Hand, hinzukommt die Rücksendung dieser digital verfassten Kommentare an die jeweiligen Schülerinnen und Schüler.
Was mir am meisten gefehlt hat war der direkte Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern – Fragen beantworten, Inhalte diskutieren oder einfach mit den Schülerinnen und Schüler über den Alltag sprechen. Zudem fehlte es, sich mit dem Kollegium auszutauschen. Insgesamt hat mir das Homeschooling – schmerzlich – gezeigt, dass Onlineunterricht nicht der Lehrberuf wäre, für den ich lebe. Es ist nämlich ein sehr schöner Beruf, wenn man wirklich von Angesicht zu Angesicht mit den Schülerinnen und Schüler kommunizieren kann und sie im Schulalltag erlebt.
War die Aufgabenfülle, die Sie aufgegeben haben, groß?
Ich habe jede Woche Aufgaben aufgegeben. Manche bezogen sich nur auf eine Woche, andere dienten zur Ausarbeitung einer Präsentation über zwei bis drei Wochen. In einigen Fällen kam die Rückmeldung, dass die Aufgaben zu schwierig waren, allerdings eher in den Klassen fünf und sieben.
Woran haben Sie bemessen, wie viele Aufgaben die Schülerinnen und Schüler von Ihnen bekommen?
Viele Unterrichtsinhalte hatte ich bereits an meiner alten Schule in Wolfsburg gelehrt, sodass ich die Arbeitsblätter oder vermehrt Lehrbuchinhalte samt Aufgaben, die ich ebenfalls in 90 Minuten bearbeitet hätte, aufgegeben habe. Ich bin immer von 60 Minuten Erarbeitungszeit ausgegangen. Allerdings muss ich auch eingestehen, dass ich einige Inhalte neu erarbeitet und umgearbeitet habe, wobei mir zu spät aufgefallen ist, dass es mehr Zeit – als eigentlich vorhanden war – gedauert hat.
War es für Sie anstrengender, am Computer zu arbeiten, anstatt in der Schule?
Es war ein anderes Arbeiten. Wie bereits zuvor erwähnt, war der Korrekturaufwand durch die Vielzahl eingeforderter Aufgaben und Rückmeldungen höher als im Schulalltag, allerdings hatte ich durch den erhöhten Zeitaufwand am PC öfter Kopf- und Augenschmerzen, während vielleicht in der Schule eher Stimme und Gehör beansprucht werden ;-).
Hatten Sie feste Abgabetermine, die die Schülerinnen und Schüler einhalten mussten?
Je nach Klassenstufe hatte ich mir für die Korrektur und Rückmeldung der Aufgaben einen Zeitplan gemacht, um eine Überfrachtung von E-Mails und Aufgaben zu vermeiden, daher haben die Klassen unterschiedliche Abgabetermine gehabt.
Haben Sie aufgegebene Aufgaben benotet?
Bestimmte Leistungen habe ich außer in Klasse fünf und sechs bewertet. Bei einigen Aufgaben habe ich die Note auch zur Wahl gestellt. In Klasse zehn und elf kam es mir verstärkt vor allem darauf an, inhaltliche wie methodische Rückmeldungen für die Oberstufe zu geben.
Fanden in Ihrem Unterricht Online-Konferenzen statt?
Ich habe nur zwei Online-Konferenzen mit meiner damaligen Klasse 6m1 durchgeführt, um organisatorische Aspekte zu besprechen. Allerdings gab es dabei bereits größere Schwierigkeiten hinsichtlich der Internetverbindung, Ton- und Bildqualität sowie der Konzentration bei den Schülerinnen und Schülern.
Herr P. Fritz (Biologie und Chemie)
Das Homeschooling war eine ganz neue Herausforderung für mich. Klar, kann ich mich im digitalen Raum bewegen und bin im Umgang mit einigen Portalen zur digitalen Wissensvermittlung geübt, aber das Ganze dann so anzuwenden und zu gestalten, dass ihr Schülerinnen und Schüler damit auch was anfangen könnt, das war schon oft eine zeitraubende Herausforderung. Am Anfang habe ich versucht, meine Aufgaben, die ich im Präsenzunterricht geben wollte, auch im Homeschooling zu verwenden, jedoch haben mir meine Schülerinnen und Schüler, vor allem die aus Klasse fünf und sieben, schnell gezeigt, dass es oft zu umfangreich war. Die Aufgabenfülle ist dann mit der Zeit weniger geworden, der Anspruch an meine Klassen ist aber nicht gesunken. Als Lehrkraft für zwei naturwissenschaftliche Fächer stand ich, am PC sitzend, vor ganz neuen Herausforderungen. Chemie von Zuhause aus unterrichten und den Jugendlichen theoretische und praktische Inhalte vermitteln – wie soll das denn gehen? Ich habe viel Zeit, Energie und damit auch Anstrengung aufgebracht, den Inhalt vor allem in Chemie so gut es geht zu veranschaulichen. Lernvideos, Experimente filmen, Präsentationen erstellen, das alles war echt anstrengend. Die meiste Zeit nahmen aber individuelle Fragen oder Anmerkungen von Schülerinnen und Schülern oder Eltern in Anspruch. In dem Zusammenhang habe ich auch ab und an Aufgaben wie Protokolle oder Präsentationen oder Lernvideos aufgegeben, die mir bis zu einem bestimmten Termin eingereicht werden sollten. Diese Aufgaben habe ich dann durchgeschaut und – insofern es eine gute Leistung war – auch benotet. Für die Benotung gab es ja ganz klare Richtlinien des Bildungsministeriums. Zusätzlich zu den Aufgaben, die ich konzipiert habe, konnte ich einige Lernseiten für den naturwissenschaftlichen Unterricht verwenden, die komplizierte Inhalte oder physiologische Abläufe angemessen vermitteln können. Insgesamt habe ich viel mit meinen Schülerinnen und Schülern über Mail kommuniziert und einige Male auch Online-Konferenzen angeboten. Leider ist die technische Ausstattung weder bei den Kids noch bei mir so super, dass alles immer reibungslos verlief. Des Weiteren wurde europaweit der Datentransfer so massiv heruntergeschraubt, um das Internet vor einem Zusammenbruch zu schützen, dass keine wirklich schönen Online-Konferenzen möglich waren. Aber die Zeit der Schulschließungen hat uns definitiv gezeigt, wo in unserem digitalen Schulalltag noch Potential nach oben ist. Ich präferiere es aber auch nach drei Jahren noch, morgens in die Schule zu fahren und euch alle zu sehen, mit euch den Unterricht zu verleben, mal ein Schwätzchen zu halten und zu lachen.
Die Lösung der Starterpacks ist, in Anlehnung an unsere kommende Ausgabe, die Abkürzung des Unternehmens, welches »Klimaretterin« im Transportsektor werden soll.
Tipp: der ehemalige Staatsbetrieb ist dafür bekannt, bei der Pünktlichkeit sehr undeutsch zu sein.
Die Lösung
Hier mit der Maus drüberfahrenUnser aller Freundin: die Bahn
Die Deutsche Bahn (DB) wurde gesucht. Die richtigen Lösungen sind daher Biologie (D) und Geschichte (B).
Birger Stepputtis (11-2)
Emma Bartlitz (11-3)
Lilly Hantusch (11-1)
Alle drei erhalten einen Thalia-Gutschein im Wert von jeweils 20 €.